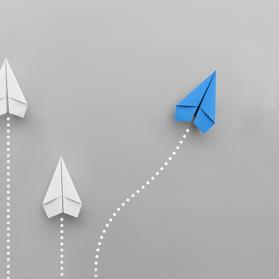Welche Maßnahmen können Unternehmen bereits heute ergreifen, um innovativ zu sein und welche Hürden gibt es zu überwinden? Im Folgenden dazu der Auszug eines Interviews mit Steffen Kuhn (Founder Detecon Digital Engineering Center) & Philipp Schett (ehem. Detecon Innovation Institute) aus der Studie "Innovative Geschäftsmodelle, Produkte und Services - Wie Unternehmen neue Umsatzpotenziale im Rahmen der Digitalisierung erschließen“ vom Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder.
Lünendonk: Innovationsfähigkeit gilt in Zeiten der Digitalisierung als überlebenswichtig. Warum aber scheitern immer noch die meisten Innovationsvorhaben?
Philipp Schett: Erst einmal: ein Unternehmen, bei dem keine Innovationsvorhaben scheitern, ist ziemlich sicher nicht innovativ. Scheitern gehört dazu – dies passiert auch im Silicon Valley ständig. Entscheidend ist eher ein durchdachtes Innovationsportfolio. Ich erkenne bei deutschen Unternehmen allerdings zwei schädliche Muster: Die Einen investieren viel zu viel Geld und Zeit, anstatt schnell mit kleinen Experimenten zu lernen und den Nutzen zu verfeinern. Die Anderen investieren dagegen zu wenig und ziehen zu früh den Stecker.
Welche Hürden lauern konkret beim Transfer von einer Idee bis in die Umsetzungspraxis?
Steffen Kuhn: Viele Faktoren sind relevant: Ein elementarer Fehler ist die unklare übergreifende Governance darüber, wie der Gesamtprozess von der Idee zur Markteinführung samt Verantwortlichkeiten funktionieren soll. Diese Gefahr besteht immer dann, wenn eine Innovationsabteilung oder Inno Hub für neue Geschäftsideen zuständig sein soll, die IT-Abteilung die Umsetzung treiben sollen und die Business-Units die Services in den Markt bringen sollen. Besser ist dagegen immer, die jeweils relevanten Funktionen und Experten frühzeitig einzubinden.
Oftmals scheitert es aber gar nicht an unklaren Prozessen, sondern an der Kultur und der Frage, ob Akzeptanz für Geduld und Fehler vorhanden ist. Ist man agil genug, um iterativ Fortschritte zu machen? Und hat man überhaupt die richtigen Experten?

Prototypen und Proof of Concepts gelten ja als wichtige Vorstufen im Innovationsprozess. Was müssen sie beinhalten, damit sie keine falschen Entscheidungsimpulse liefern?
Kuhn: Digitale, als auch Hardware-Prototypen müssen die Ergebnisse der vorangehenden Überlegungen sicht- und anfassbar machen. Das ermöglicht es, pragmatisch zu evaluieren und weiter zu verbessern. Hier sprechen wir von User Centered Design, wobei der Nutzer von Anfang an involviert sein sollte. Die Herausforderung besteht darin, den Prototypen in seiner Komplexität einfach zu halten und gleichzeitig alle relevanten Funktionen abzubilden. Die Anforderungen sind daher so präzise wie möglich zu schärfen. Je besser das gelingt, umso aussagekräftiger wird der Prototyp.
Meist lautet die Gretchenfrage: Müssen Innovationen in gesonderten Einheiten entstehen oder sollten sie in bestehende Strukturen eingebettet sein, damit sie nicht am langen Arm der Unternehmensrealität verhungern? Was raten Sie?
Schett: Platz sollte für beides im Innovationsportfolio sein. Aber wirklich disruptive Ideen müssen in externen Einheiten hervorgebracht werden. Einerseits um der meist irrationalen Angst, sich selbst zu kannibalisieren, entgegenzuwirken. Andererseits aber auch, weil Strukturen, die darauf ausgelegt sind, ein bestehendes Geschäftsmodell möglichst effizient auszuführen, eben nicht dafür geeignet sind, ein Neues zu identifizieren: Mitarbeitern brauchen hierfür andere Freiheiten, aber auch andere Anreizsysteme – und eventuell sind auch andere Investoren notwendig.
Ökosysteme aus Unternehmenspartnern, Hochschulen und Startups gelten mit Blick auf Cyber-Hochburgen wie dem Silicon Valley oder Beerscheba in Israel als besonders erfolgversprechend. Wie können Unternehmen erkennen, welche Partner die richtigen für die eigenen Ziele sind?
Schett: Voraussetzung ist zunächst Klarheit bei eigenen Zielen: Gute Startups können sich gute Partner mittlerweile aussuchen, und viele Startups sind berechtigterweise vorsichtig geworden. Denn oft haben Großkonzerne nur ein Innovationstheater, also Innovation zum Marketingzweck, aufgeführt oder sind Partnerschaften ohne Plan eingegangen. Wenn die Ziele klar sind, ist weiterhin zu klären, ob Kultur, Planungshorizont und Geschwindigkeit zueinander passen.
Kuhn: Zusätzlich ist es wichtig, mit konkreten Projekten, die beiden Seiten Vorteile bieten, auf Startups und Partner zuzugehen und den eigenen Modus Operandi in der Zusammenarbeit zu finden. Für etablierte Unternehmen ist es natürlich sexy, mit Startups technologische Ideen zu realisieren. Aus Sicht des Startups, dessen „Margin for Error“ deutlich geringer ist, wird es aber komplexer – attraktiv ist nur, wer kurze Entscheidungszyklen, einfache Prozesse und klare Verantwortlichkeiten mitbringt. Hier mit offenen Karten zu spielen ist das A und O. Wir empfehlen, immer einen Mix aus Industrie-, Forschungsorganisationen und Start Ups im Ecosystem zu haben. Wie bei einem guten Menü zählt dann die richtige Dosis von Zutaten.
Die Studie wie auch das vollständige Interview stehen hier zum Download bereit.